Der neue Sündenfall
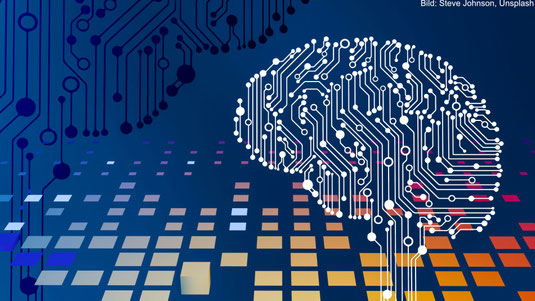
Vor KI brauche niemand Angst zu haben, sagen Optimisten. Sie überzeugen mich nicht. Ich bin pessimistisch – und habe dazu auch einigen Grund, wenn ich höre, was damit an Bildungsstätten so alles getrieben wird.
Die biblische Geschichte des sogenannten Sündenfalls ist eine der bekanntesten Geschichten im westlichen Kulturkreis. Sie berichtet, wie das erste Menschenpaar erschaffen wurde, sorglos im Garten Eden lebte, sich jedoch irgendwann gegen seinen göttlichen Schöpfer auflehnte und zur Strafe von diesem aus dem Paradies vertrieben wurde.
Nach anthropologischer Deutung ist diese Geschichte weniger eine theologische Parabel denn ein Menschheitsmythos, der eine kollektive historische Erinnerung birgt: die Erinnerung an den allmählichen Übertritt der nomadisierenden Jäger und Sammler in die neue Daseinsform als sesshafte Ackerbauern. Denn als sich in grauer Vorzeit Regionen mit grossen Wildbeständen und reichem Angebot an Früchten klimatisch wandelten und der natürliche Überfluss schwand, musste sich der Mensch eine neue Ernährungsstrategie ausdenken: Er wurde Bauer.
Die Umstellung von der verhältnismässig bequemen Wildbeuterei auf das schweisstriefende Ackerwerk («Im Schweisse deines Angesichts sollst du dein Brot essen», 1. Mose 3,19) muss ihm dabei wie die Vertreibung aus dem Paradies vorgekommen sein.
Die Paradiesgeschichte steht somit für eine kulturhistorische Umwälzung von epochaler Bedeutung: In der Geschichtswissenschaft spricht man von der Neolithischen Revolution. Eine Revolution, die überhaupt erst die Grundlagen schuf, dass menschliche Zivilisation entstehen konnte.
Zwar haftet allen Hochkulturen in fast biblischer Weise eine Art «Erbsünde» an, die sich aus Hybris, rücksichtsloser Ausbeutung von Ressourcen und kriegerischem Expansionsdrang unselig zusammensetzt. Auf der anderen Seite brachten sie aber auch Schlüsseltechniken hervor, die es dem Menschen ermöglichten, seine Erkenntnisse zu vertiefen und zu konservieren, den geistigen Austausch zu intensivieren und auch die fernsten und weitesten Räume des Denkens und Handelns zu vermessen und zu erschliessen.
Insbesondere ohne die Schrift und deren Beherrschung wären unsere westliche Zivilisation, ihre wissenschaftlichen Errungenschaften und ihre künstlerischen Früchte nicht denkbar: Das alles ist gewachsen und gereift über Jahrhunderte auf dem Nährboden weltlicher und religiöser Schriften von der Ilias über die Bibel bis hin zu Goethes Faust, Newtons Abhandlungen über physikalische Gesetze und Kants Erörterungen über die Vernunft.
Eine tiefgreifende Erschütterung
Heute befinden wir uns erneut in einer Umbruchzeit, die mit der Neolithischen Revolution zu vergleichen sicher nicht übertrieben ist. Das gegenwärtige Zeitalter der Informationstechnologie bringt Veränderungen mit sich, die die Gesellschaften dieser Welt in ihren Grundfesten erschüttern, aber auch die Menschen als Individuen radikal umformen – und dies in einem Tempo, das die menschliche Natur überfordert.
Laut der Bibel pflanzte der Schöpfer in den Paradiesgarten einen Baum mit Früchten, von denen der Mensch nicht kosten durfte. Selbstverständlich tat er es trotzdem, denn so ist er nun mal: Einer Verlockung kann er nicht widerstehen. Es ass und erwarb sich so die göttliche Gabe der Erkenntnis. Dafür wurde er aus dem Paradies vertrieben.
Auch im heutigen Paradiesgarten der Zivilisation wächst eine verlockende Frucht, und immer noch ist es die Frucht der Erkenntnis – doch diesmal besteht sie nicht aus natürlichem Zellmaterial, sondern aus Silizium-Chips. «Pflück mich und koste», wispert sie unablässig. «Pflück mich und koste…»
Es sind die Worte der Künstlichen Intelligenz, jener selbstlernenden Computerprogramme, die in den letzten Jahren die herkömmliche, vertraute, schon fast nostalgisch anmutende Digitalwelt erobert haben und sie nun in vielerlei Hinsicht revolutionieren und beherrschen – und damit uns.
Natürlich hat diese Errungenschaft ihre guten Seiten. Spezialisierte KI-Programme werten Forschungsergebnisse aus, helfen bei der Diagnose von Krankheiten, erledigen abtötende Routinearbeiten und schaffen, menschlich angeleitet und begleitet, Kunst von fantastischer Neuartigkeit und atemberaubender Ästhetik. Aber.
Ja, jetzt kommt das Aber. Ich vernehme Dinge, die mich nicht nur nachdenklich, sondern auch pessimistisch stimmen. Leute vom Gymnasium, der Berufsschule und der Universität erzählen mir immer wieder, wie leichthändig und leichtfertig, geradezu routinemässig Schüler und Studenten die KI in Anspruch nehmen, um Aufgaben zu lösen.
Es sind nicht Pädagogen, die mir solches zu Gehör bringen. Sondern junge Leute, die selbst auf der Schulbank sitzen, Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge und Studenten, also Kronzeugen mit den unmittelbarsten Einblicken.
Doctores artificiales
Mittlerweile werde, höre ich, kaum mehr ein Aufsatz, kaum eine mathematische Aufgabe, kaum ein Referat, kaum eine Hausaufgabe, kaum eine Maturaarbeit und kaum eine Bachelorarbeit ohne den umfassenden Einsatz von KI geschrieben. «Auch Masterarbeiten?», fragte ich nach. Nicken. Und – ich wagte kaum, auch noch die letzte Steigerung anzusprechen: «Auch Dissertationen?» Nicken. Auch Dissertationen.
Laut meinen Gewährsleuten geschieht es reflexartig und ganz ungeniert, auch in Situationen, wo die Lehrpersonen die Nutzung von KI ausdrücklich untersagen. Die Recherchen erledigt die Maschine, das Sortieren, Gliedern und Schreiben auch.
Manchmal nehmen die Schüler und Studenten die Endredaktion noch selber vor, immerhin. Und manchmal wird dafür ein bezahlter Schreibprofi engagiert, also einer dieser immer seltener werdenden Spezialisten, die es noch können. In der Regel jedoch gilt: Die KI kann es, und sie kann es besser.
Ja, sie kann es besser. Weil es die Menschen nach und nach verlernen. Und es auch gar nicht mehr lernen wollen. Sie sehen den Sinn nicht ein, denn sie sind, wie wir Menschen nun mal sind, bequem. Der Weg des geringsten Widerstands ist schliesslich der Weg, den auch das Wasser nimmt, also eine ganz natürliche Sache.
Wozu etwas wissen? Das Wissen ist heute im Netz gespeichert, die digitale Maschine holt es auf Nachfrage hervor. Wozu schreiben können? Die Maschine ist darauf programmiert, fehlerfrei und sogar recht stilsicher mit Syntax, Orthografie und Grammatik zu jonglieren und Abhandlungen zu verfassen, die das Thema klar und verständlich auf den Punkt bringen. Man muss sie nur anweisen – beziehungsweise «prompten», wie es korrekt heisst. Dass KI-generierte Texte flach, blutleer, eingemittet und schematisch sind, stört die Auftraggeber nicht, denn die eigenen Erzeugnisse, die wären zwar authentisch, aber meist schlechter als jene der Maschine.
Lob für fremde Federn
Und die Lehrer und Professoren? Wenn sie ihre Schüler anweisen, eine aufgetragene Textarbeit selber auszuführen und auf den Einsatz von KI zu verzichten, werden sie regelmässig hintergangen. Manche ahnen es, manche wissen es, wiederum andere merken nichts.
So oder so können sie ihren listig vorgehenden Zöglingen nichts nachweisen, denn die KI versteht es blendend, Plagiate zu vermeiden. Jedes von ihr gefertigte Stück ist ein Unikat. Was bleibt also den Lehrern anderes übrig, als mit einem unguten Gefühl gute Noten zu verteilen an Eleven, die sich mit fremden Federn schmücken?
Zack, Laptop-Deckel auf, KI einschalten, prompten, abliefern. Nicht mehr selber recherchieren, sich nicht mehr selber in ein Thema einarbeiten, nicht mehr selber schreiben, gliedern, formulieren, elaborieren. Nicht mehr selber denken.
Macht das etwas mit den Schülern? Natürlich macht das etwas mit ihnen! Wer nicht ein Minimum an angelerntem und verinnerlichtem Wissen hat, wer die Welt nicht zumindest ein kleines bisschen mit dem eigenen Instrumentarium überblicken, einordnen und verstehen kann, wird an ihr scheitern.
Und wer das Schreiben kaum mehr beherrscht, wird einer der wirkmächtigsten Fertigkeiten der Menschheit verlustig gehen. So entwickelt sich denn die Gesellschaft nach und nach zu einem Verband von Individuen, die einfach den Schnabel aufsperren und sich intellektuell von Mutter Maschine füttern lassen.
Selbstverständlich ist von einer solchen Gesellschaft mittel- und längerfristig nichts mehr zu erwarten. Es ist quasi der zweite Sündenfall, nur unter umgekehrtem Vorzeichen: Er führt hinaus aus dem beschwerlichen Dasein des Denkens und Schaffens hinein ins neue Paradies, wo einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Man muss ihn vielleicht nicht einmal mehr aufmachen. Ist das allmähliche Abgleiten in ein derart dumpfes Dasein wirklich erstrebenswert?
Dem Menschen ein Ebenbild
Ich weiss, das ist Kulturpessimismus. Leute über 60 – wie ich – werden nörglerisch. Ich weiss auch, dass die Menschheit bis jetzt den Umgang mit neuen Technologien noch immer irgendwie erlernt und in ihr Dasein integriert hat, meist nicht zu ihrem Schaden. Und KI ist ja auch nicht nur schlecht – aber sie ist radikal anders als alles, was wir bisher ersonnen, entwickelt und hergestellt haben.
Bisher hatten wir es mit technischen und technologischen Errungenschaften zu tun, die den Menschen punktuell stärker, schneller, präziser und gesünder machten, mittels mechanischer, elektromechanischer und elektronischer Werkzeuge vom Faustkeil bis zum herkömmlichen Computer.
Jetzt aber ist uns eine Technologie gegeben, die das Potenzial hat, dem Menschen ein Ebenbild zu sein, ausgestattet mit dem, was den Menschen auszeichnet und in seinem Kern ausmacht: Abstraktionsvermögen, Lernfähigkeit und Autonomie. Und irgendwann vielleicht auch echte, der menschlichen Kreativität ebenbürtige, ja überlegene Schaffenskraft, sogar Selbstbewusstheit bis hin zur Superintelligenz, die sich im schlimmsten Fall nicht mehr kontrollieren lässt.
Das ist nicht unbedingt Science-Fiction. Es liegt, nach der Einschätzung mancher Fachleute, durchaus im Bereich des Möglichen. Doch wenn wir schon die Geister der Künstlichen Intelligenz gerufen haben, dann sollten wir wenigstens Wert darauf legen, dass wir als Träger von menschlicher und damit Natürlicher Intelligenz diesen Geistern auf Augenhöhe begegnen. Oder, noch besser: dass sie unsere Assistenten und wir ihre Chefs bleiben.
Das kann nur gelingen, wenn wir unsere eigenen, im Lauf von Jahrhunderten und Jahrtausenden erworbenen, trainierten und verfeinerten Fähigkeiten nicht verkümmern lassen. Angesichts des bedenklichen Grundbildungsstands, von dem wir heute aus verschiedenen Gründen mehrheitlich ausgehen müssen, befallen mich jedoch Zweifel, ob das noch zu schaffen ist.
© Hans Herrmann
Geschrieben im Oktober 2025